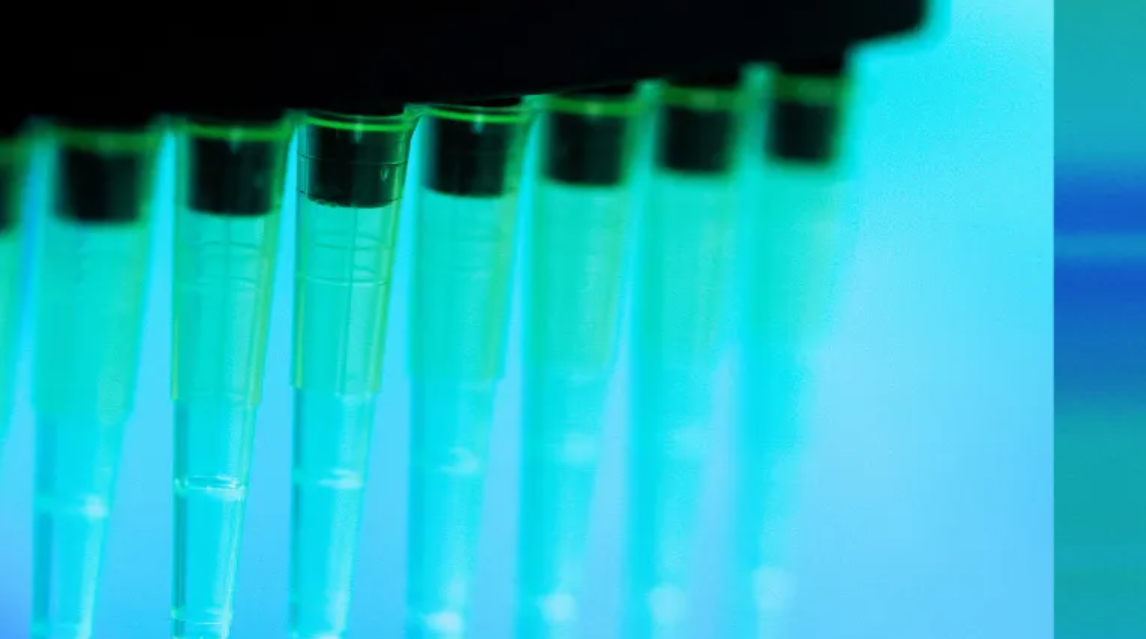Neue Technologien beherrschen die Schlagzeilen – doch in der Praxis zeigt sich immer wieder: Bis Innovationen in den bestehenden Produktionsalltag Einzug halten, braucht es vor allem eins – Zeit, Geld und Ressourcen.
Das gilt auch für KI. Ihr Potenzial für die Pharmaindustrie ist unbestritten – gerade auch in der Produktion. Aber um es zu realisieren, müssen Unternehmen etablierte Prozesse überdenken und Investitionen in die Wege leiten.
Zühlke begleitet als Beratungs- und Umsetzungspartner viele Unternehmen genau auf diesem Weg – und kennt die zentralen Herausforderungen:
- Wie können Unternehmen Kapital aus anderen Bereichen freisetzen, um in KI zu investieren?
- In welchen Bereichen der Produktion lassen sich gezielt Effizienzpotenziale heben – und wie lassen sich diese wirtschaftlich sinnvoll umsetzen?
- Wie können Unternehmen den großen Druck, unter dem die Branche steht, für nachhaltige Veränderungen nutzen?
Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir beim diesjährigen World Health Summit ein Panel mit führenden Köpfen der Branche veranstaltet.
Im Gespräch mit Lisa Bonadonna von der African Vaccine Manufacturing Initiative (AVMI), Josh O’Hara, Leiter Public Policy & Regulatory Law bei Eli Lilly, sowie Dr. Marc-Alexander Mahl, President of Pharma, Nutrution and Sustainability bei Fresenius Kabi, moderierte Dr. Angeli Möller, Chief Health Officer bei Zühlke, eine Diskussion darüber, wie KI ganz konkret zur Zukunft der pharmazeutischen Produktion beitragen kann – sowohl als Werkzeug als auch als Impulsgeber.
Hier erfahren Sie, was wir dabei gelernt haben:

KI in der Produktion
Wo genau KI in der Pharmaindustrie den größten Nutzen bringt, wird vielerorts noch ausgelotet. Doch erste Erfolge zeigen sich dort, wo Daten ohnehin vorhanden sind – also direkt in der Produktion: zum Beispiel bei Predictive Maintenance, der Ertragsoptimierung pro Durchlauf, der Produktionsplanung oder in der Lieferkette.
„Viele Unternehmen, mit denen wir weltweit arbeiten“, erklärt Dr. Angeli Möller „beschäftigen sich inzwischen intensiv damit, wie sie KI gezielt in Produktion und Supply Chain integrieren können.“
Der Druck, hier schnell zu handeln, ist hoch.
Im Gespräch wurde deutlich, dass selbst traditionell nicht-technische Bereiche – etwa Legal und Compliance – zunehmend aufgefordert werden, KI-Initiativen umzusetzen. Dr. Marc-Alexander Mahl verweist in diesem Kontext auf die größere Vision: „Damit Produkte zur richtigen Zeit sowie in der richtigen Menge und Qualität verfügbar sind, braucht es gezielte Investitionen – in die Weiterbildung der Mitarbeitenden, moderne KI-gestützte Prognoselösungen, Planungstools für die Produktion und digitale Werkzeuge für das Supply Chain Management. Nur so lässt sich die Produktionsplanung effizient gestalten und der Materialeinsatz optimal steuern.“
Gerade die Pandemie – und in Folge auch geopolitische Spannungen – haben gezeigt, wie verwundbar Lieferketten sein können. Umso wichtiger, dass KI hier nicht nur hilft, den Normalbetrieb effizienter zu gestalten, sondern auch, sich auf Extremsituationen vorzubereiten.
Kurz gesagt: KI in der Pharmaproduktion ist vor allem eins – ein Motor für operative Exzellenz.
Und der wirkt am stärksten dort, wo Daten bereits vorhanden sind und Use Cases greifbare Ergebnisse liefern. Viele Unternehmen profitieren bereits: von effizienteren Personalplanungen bis hin zu KI-unterstützten Regulierungsdokumenten. Andere hinken noch hinterher – und, so Dr. Angeli Möller: „Die müssen jetzt irgendwie das nötige Kapital mobilisieren, um nicht den Anschluss zu verlieren.“
Die Herausforderung: KI im großen Stil skalieren
Pilotprojekte gibt es genug – aber die Skalierung in die Breite bleibt oft eine große Herausforderung. Unsere Erfahrung: Um KI wirklich zu skalieren, braucht es klare Prioritäten, eine strukturierte Umsetzung – und ein Umdenken auf allen Ebenen. Dr. Angeli Möller bringt es auf den Punkt: „Ein zentrales Problem in der Pharmaproduktion ist die fehlende Datenharmonisierung – gerade bei älteren Standorten. Daten nachträglich konsistent und teilbar zu machen, ist oft der erste grosse Schritt.“ Wie dieser gelingen kann? Indem Unternehmen bestehende Engpässe und Komplexitäten in der Lieferkette reduzieren – und so neue Freiräume für Investitionen schaffen. Entscheidend sind dabei drei Denkansätze:
1. Daten auditieren und harmonisieren
Unser Panel war sich einig: Die eigentliche Herausforderung liegt oft nicht in der Qualität der KI-Modelle, sondern in der fehlenden Verfügbarkeit valider, harmonisierter Daten. Gerade wenn Daten in Silos über verschiedene Standorte hinweg liegen, wird der Einsatz von KI zur echten Hürde. Eine Plattformstrategie mit standardisierten, überprüfbaren Datenmodellen ist daher der erste wichtige Schritt zur Skalierung.
Lisa Bonadonna von der African Vaccine Manufacturing Initiative (AVMI): „Wir wollen die Richtlinien der WHO für die Vorqualifizierung von Impfstoffen nutzen.“ Sie erläutert, dass derzeit nur etwa 1 % der in Afrika benötigten Impfstoffe auf dem Kontinent selbst produziert werde – und dass ein gemeinsamer Qualitätsstandard entscheidend sei, um die Produktionskapazitäten vor Ort zu stärken.
2. Ein gemeinsames Ökosystem vor dem Wettbewerb fördern
Ein zentrales Learning unserer Diskussion: Lieferketten werden widerstandsfähiger, wenn Kompetenzen und Kapazitäten dezentral organisiert sind.
Aus diesem Grund setzen sowohl Lisa Bonadonna als auch Dr. Marc-Alexander Mahl auf Kooperation: „Nicht alle können alles. Deshalb arbeiten wir mit 25 Herstellern zusammen – darunter drei Vorreiter, die als Blaupause für alle anderen dienen“, erklärt Lisa Bonadonna.
Dr. Marc-Alexander Mahl kommentiert: „Wenn Sie die Lieferkette entlasten wollen, müssen Sie ein Umfeld schaffen, in dem Kompetenzen, Fähigkeiten und Kapazitäten regional gebündelt werden – nicht nur für einzelne Wirkstoffe oder Technologien, sondern für alles.“ Wenn man das einzelnen Firmen überlasse, die jeweils nur in das investierten, was für sie interessant sei, führe das zu einem eingeschränkten Angebot und geringerer Versorgungssicherheit.
„Eine Möglichkeit besteht darin, regionale Kapazitäten für wichtige Arzneimittel über ein industriegesteuertes Netzwerk aufzubauen – mit koordinierten Investitionen in essenzielle Wirkstoff-Vorprodukte (APIs) in Europa oder den USA. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Pharmaherstellern lässt sich die lokale Versorgung stärken, die Resilienz erhöhen und die Abhängigkeit verringern – ganz nach dem erfolgreichen Kooperationsmodell von Airbus.“
3. Die richtigen Partner wählen
Das Panel war sich einig, dass Partnerschaften ein entscheidender Faktor ist, um KI-Fähigkeiten zu skalieren. Viele Unternehmen verfügen bereits über wachsende interne Expertise, sind jedoch auf Technologiepartner angewiesen, um Kompetenzlücken zu schließen und Implementierungen zu beschleunigen.
Dr. Marc-Alexander Mahl betont dabei die Rolle eines strategischen Einkaufs: „Beschaffung ist Politik. Und die darf sich nicht nur am Preis orientieren.“
Der Vorteil: Gute Partnerschaften reduzieren Risiken – sowohl bei der KI-Einführung als auch im Lieferkettenmanagement. Wichtig ist dabei ein flexibles Setup: mit hybriden oder lokalen Datenmodellen, regelmässiger Validierung und skalierbaren Schnittstellen.
So bleiben Unternehmen unabhängig – und können neue Lösungen schneller ausrollen.
Was wirklich zählt: Ergebnisse, die einen Unterschied machen
In unserem Panel wurde klar: Geopolitik, neue Technologien und Lieferketten sind keine getrennten Sphären – sie bedingen sich gegenseitig. Nur wer seine Lieferketten zukunftsfähig aufstellt, schafft Raum für neue Technologien wie KI.
Das Ziel ist dabei klar: „Wir arbeiten daran, Medikamente schneller, günstiger und effizienter bereitzustellen – damit mehr Menschen weltweit versorgt werden können“, so Dr. Angeli Möller.
Denn letztlich geht es bei jedem Technologiewandel nicht um Technik, sondern darum, Patient:innen den Zugang zu Therapien zu erleichtern. Wenn KI dabei hilft, wettbewerbsfähiger zu werden – umso besser.
Oder wie Dr. Marc-Alexander Mahl es ausdrückt: „Wettbewerbsfähigkeit ist der Schlüssel, um die Gesundheitssysteme zu entlasten und zu stärken.“
Um von Pilotprojekten zur Produktion überzugehen, ist die Agenda klar: Arbeiten Sie mit den richtigen Partnern zusammen, und Sie werden sowohl auf Makro- als auch auf Mikroebene Resilienz aufbauen. Eine praktische Einschätzung zur Zukunft der KI in der Pharmabranche finden Sie im Branchenbericht von Zühlke: