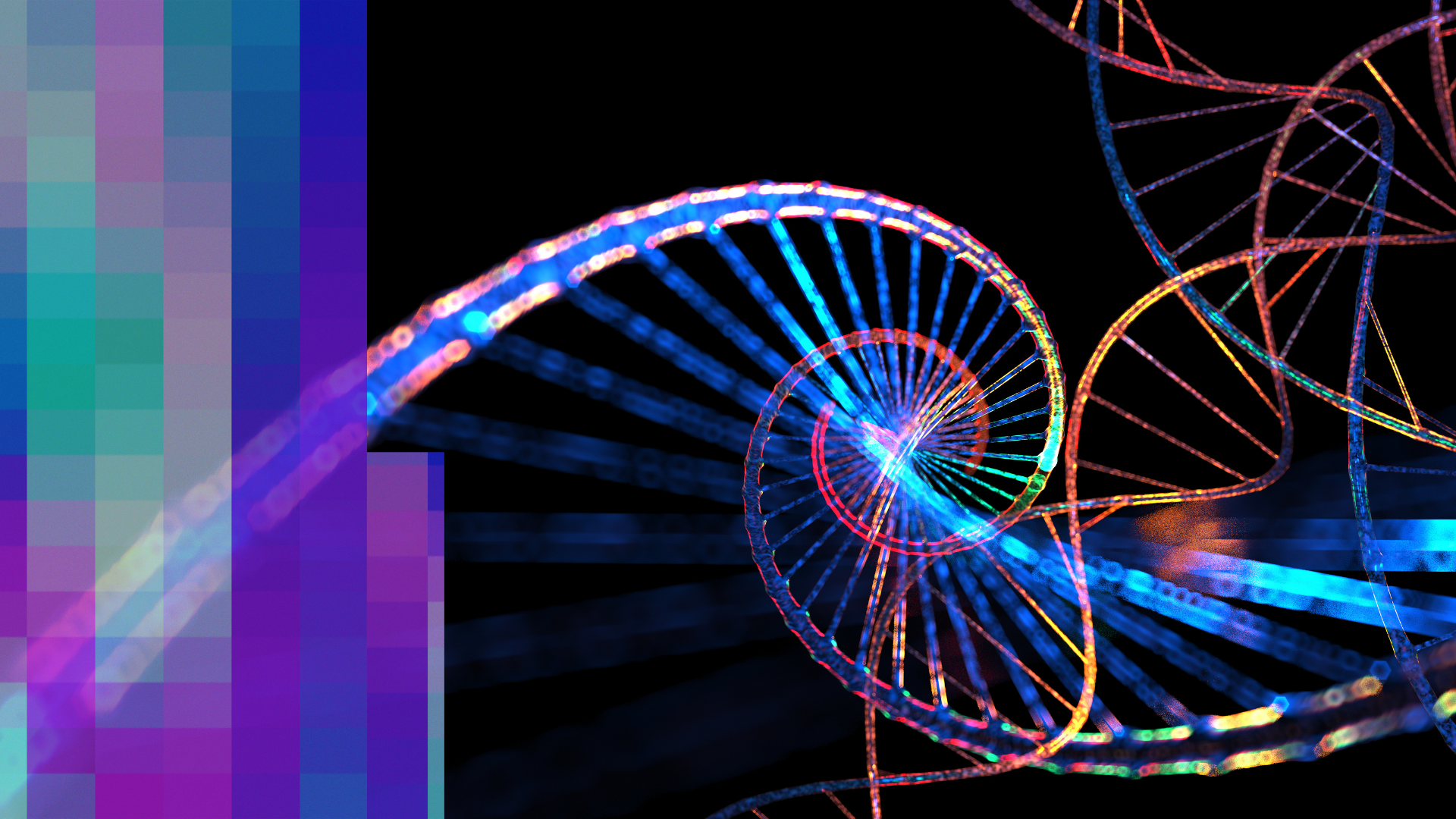KI revolutioniert die Wirkstoffforschung. Digitale Zwillinge – virtuelle Abbilder biologischer Systeme – beginnen die Art und Weise zu verändern, wie Wissenschaftler neue Behandlungen testen, vorhersagen und validieren. Doch können diese Technologien Tierversuche vollständig ersetzen?
In dieser Folge von Tech Tomorrow spricht Zühlkes David Elliman mit Professorin Julie Frearson, Chief Scientific Officer bei Charles River Laboratories, über die Chancen und Grenzen dieses Wandels – und wie die Zukunft der vorklinischen Forschung tatsächlich aussehen könnte.
Über die Gesprächspartnerin: Professorin Julie Frearson
Professorin Julie Frearson ist Senior Vice President und Chief Scientific Officer bei Charles River Laboratories, einem der weltweit führenden Partner in der Arzneimittelforschung und -entwicklung. Sie leitet die strategischen Risikofonds und Innovationspartnerschaften des Unternehmens und hat ihre gesamte Karriere an der Schnittstelle zwischen pharmazeutischer Wissenschaft und technologischer Innovation verbracht.
Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der frühen Wirkstoffforschung bietet sie eine bodenständige, praxisnahe Perspektive darauf, wie KI und digitale Zwillinge die Branche verändern – und warum Tierversuche sich weiterentwickeln werden, anstatt zu verschwinden.
Zentrale Erkenntnisse der Episode
KI verändert bereits die frühe Wirkstoffentdeckung
Für kleine Moleküle ist KI schon heute ein unverzichtbares Werkzeug. Algorithmen helfen Wissenschaftlern dabei, neue chemische Verbindungen zu identifizieren, vorherzusagen, ob sie an die richtigen biologischen Ziele binden, und ihre pharmakologischen Eigenschaften zu modellieren.
Professorin Frearson erklärt: „Am Computer kann man viel größere Experimente durchführen und deutlich mehr chemischen Raum untersuchen, als es mit traditionellen experimentellen Verfahren möglich wäre.“
Das Ergebnis sind schnellere Entdeckungszyklen und gezieltere Experimente. Doch Professorin Frearson warnt: Kostensenkung ist nicht das zentrale Thema; der wahre Wert liegt in Qualität und Umfang. Kurz gesagt: KI erlaubt es Forschern, mehr Möglichkeiten zu erkunden und das deutlich früher. Das setzt natürlich voraus, dass die Labore in der Lage sind, qualitativ hochwertige, KI-fähige Daten in großem Umfang zu erzeugen.
Virtuelle Tiere sind keine Science-Fiction mehr
Eine der auffälligsten Entwicklungen ist der Aufstieg digitaler Zwillinge – virtueller Modelle, die biologische Systeme abbilden. In der Wirkstoffforschung bedeutet das: virtuelle Tiere.
Professorin Frearson erklärt, dass die Technologie zwar noch nicht so weit ist, virtuelle Tiere zu schaffen, welche die Unterschiede zwischen behandelten und unbehandelten Tieren realistisch darstellen. Forscher setzen aber bereits heute virtuelle Tiere zur Ersetzung von Kontrollgruppen ein.
Anstatt lebende Kontrolltiere zu verwenden, die oft redundante Daten liefern, nutzen Wissenschaftler retrospektive Datensätze, um diese Kontrollen zu simulieren. Charles River hat in über 20 Studien gezeigt, dass der Ersatz von Kontrolltieren durch virtuelle Tiere keine Auswirkungen auf die Versuchsergebnisse hat.
Das ist ein praktischer, ethischer und wissenschaftlicher Fortschritt – weniger Tierverbrauch bei gleichbleibender Datenqualität.
Die Komplexitätsfalle: Warum vollständige Virtualisierung noch weit entfernt ist
Können wir also ein vollständig virtuelles Lebewesen erschaffen? Noch nicht – und vielleicht auch nicht so bald. „Man würde alle verblüffen, wenn man wirklich versuchen würde, einen virtuellen Menschen oder ein virtuelles Tier auf Basis der heutigen Daten zu bauen“, sagt Professorin Frearson.
Stattdessen verfolgt die Branche einen modularen Ansatz, indem Modelle für spezifische Systeme wie Leber, Herz oder Nieren entwickelt werden – Organe, bei denen Toxizität häufig zu Medikamentenversagen führt. Mit diesen Teilmodellen können Forscher Sicherheitsprobleme viel früher erkennen.
Regulierungsbehörden öffnen vorsichtig die Tür
Regulierungsbehörden beginnen, das Potenzial von KI und digitalen Modellen anzuerkennen. Die US-amerikanische FDA hat bereits mehrere in silico-(computerbasierte) Modelle zugelassen, und die europäische EMA unterstützt seit Langem neue methodische Ansätze (NAMs), wo diese wissenschaftlich sinnvoll sind.
Doch die breite Einführung wird Zeit brauchen. Professorin Frearson merkt an: „Selbst in zehn Jahren werden die Regulierungsbehörden wahrscheinlich noch hybride Datensätze prüfen – eine Kombination aus KI-basierten Vorhersagen und in vivo-Daten.“
Erklärbarkeit ist das neue Sicherheitsnetz
In sicherheitskritischen Bereichen wie der Arzneimittelentwicklung ist undurchsichtige („Black Box“-)KI nicht akzeptabel.
David Elliman formuliert es so: „Wenn man nicht erklären kann, warum die KI eine Entscheidung getroffen hat – wie kann man ihr dann wichtige Entscheidungen anvertrauen? Erklärbarkeit ist kein Bonus, sondern Pflicht.“
Professorin Frearson stimmt zu, dass menschliche Aufsicht unverzichtbar bleibt:
“Wir modellieren unglaublich komplexe Systeme. Es wird immer einen Menschen im Zentrum geben müssen – der Ergebnisse prüft, Entscheidungen trifft. Wenn wir diesen Prozess entmenschlichen, würden wir auf einen gefährlichen Pfad geraten.”
Genau deshalb werden Governance-orientierte Ansätze für KI – bei denen Transparenz, Verantwortlichkeit und Compliance von Anfang an miteinbezogen sind – immer unabdingbarer.
Das Tempo der Technologie vs. das Tempo der Regulierung
Technologie entwickelt sich oft schneller als Gesetze – und dieser Widerspruch zeigt sich besonders in der Pharmaforschung. Doch Frearson sieht darin nicht unbedingt ein Problem.
„Man kann enorm vom technologischen Tempo in den frühen Phasen der Wirkstoffforschung profitieren“, sagt sie. „Dort, wo die Regulierer noch nicht involviert sind, können wir experimentieren – solange wir nicht die Kontrolle verlieren.“
Mit anderen Worten: Innovation darf sich früh entfalten, wo die Risiken geringer sind; Regulierung sorgt später für Sicherheit und Vertrauen.
Werden KI und digitale Zwillinge Tierversuche also überflüssig machen?
“Es ist sehr schwierig, sich vorzustellen, dass etwas so Komplexes wie die menschliche Biologie ausschließlich durch rechnerische Modelle abgebildet werden kann. Uns fehlt schlicht die Technologie, um jedes Element der Biologie heute vorherzusagen.”
Zwillinge und KI werden Tierversuche nicht abschaffen – aber sie verändern grundlegend, was in der Arzneimittelforschung möglich ist. Mit zunehmender Reife dieser Modelle werden Studien kleiner und gezielter, Entwicklungszyklen kürzer, und das Verständnis von Sicherheit und Wirksamkeit tiefer.
Schätzungen zufolge verstehen wir nur etwa 5 % der menschlichen Biologie. Es liegt also noch ein weiter Weg vor uns, bevor Simulation Experimente ersetzen kann. Doch obwohl Technologie Biologie nicht ersetzt, hilft sie uns, bessere Fragen zu stellen. Und genau dort beginnen echte Durchbrüche.