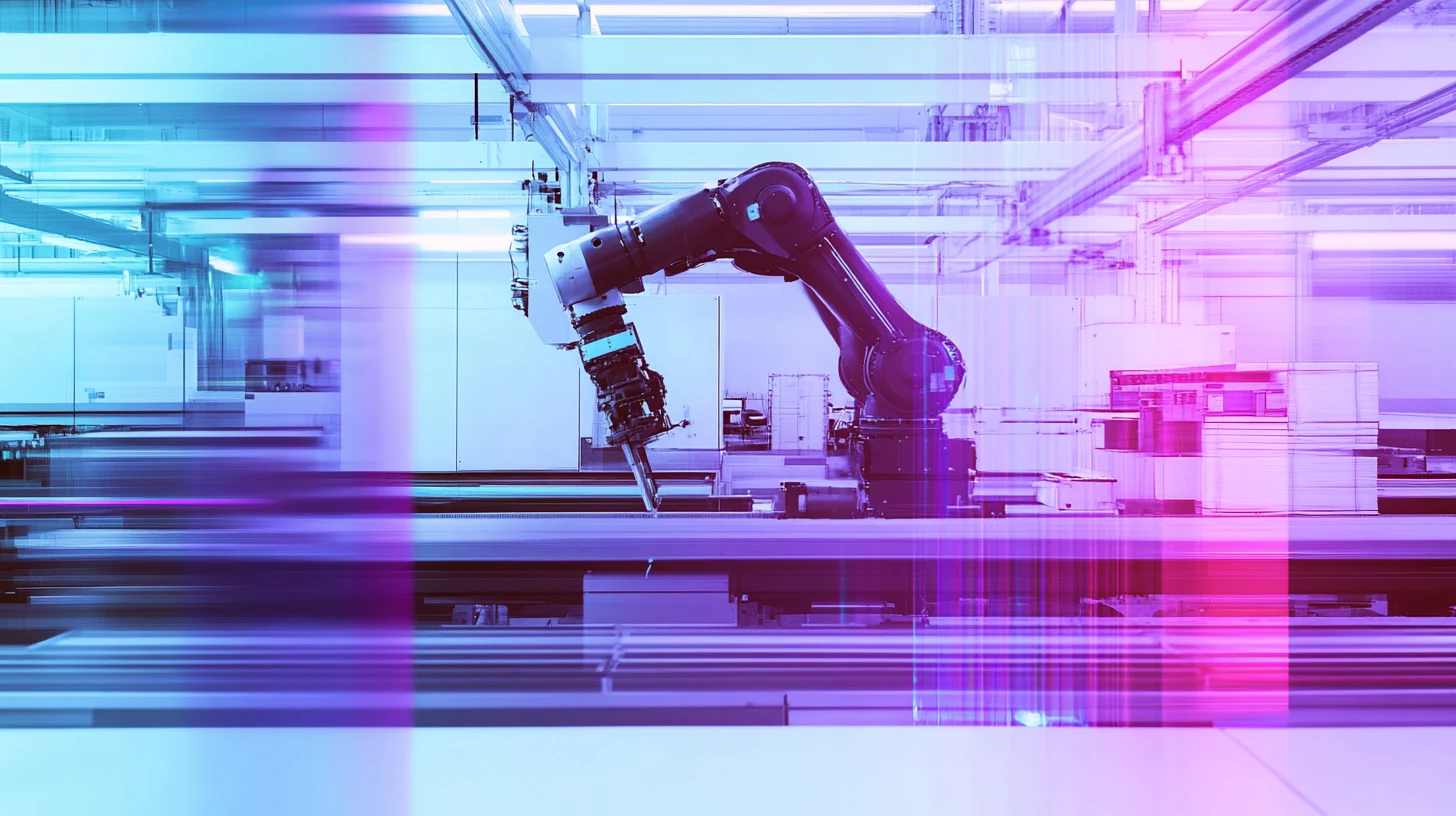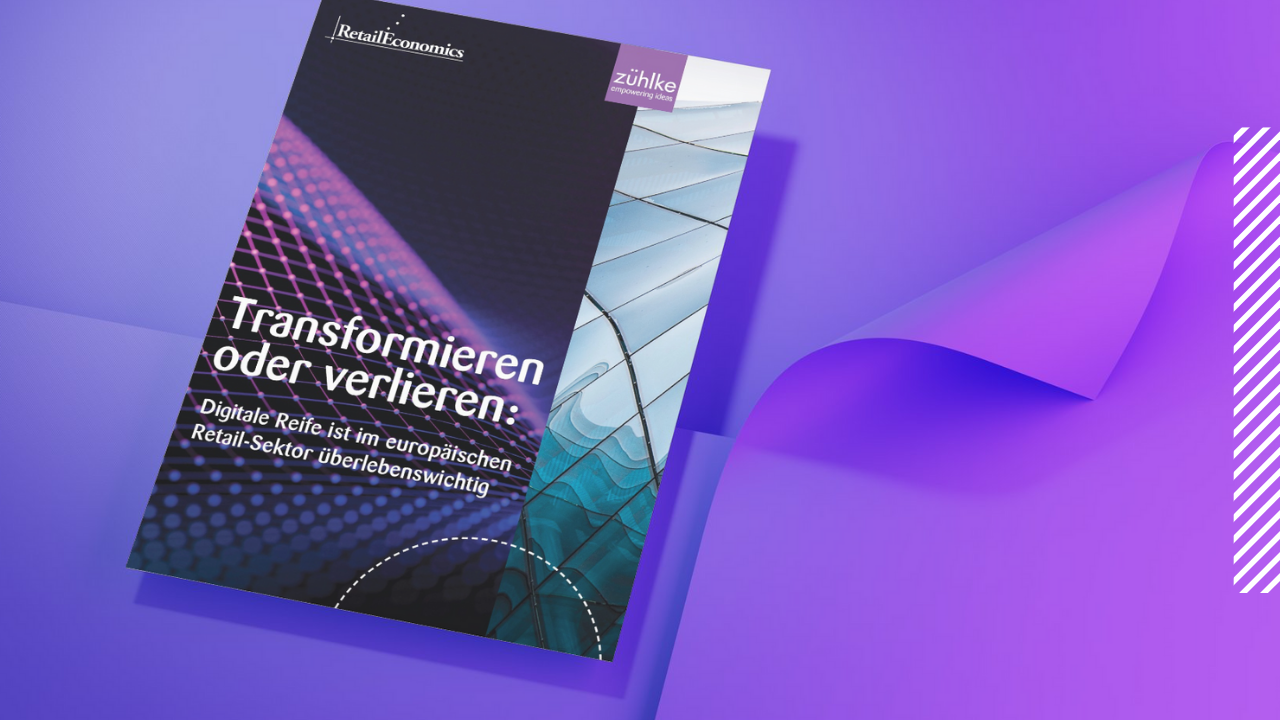Industrial AI wird oft als Allheilmittel für die Herausforderungen der Industrie propagiert. Unsere Erfahrung zeigt jedoch: Die Realität sieht anders aus. Viele Initiativen starten mit großem Enthusiasmus, bleiben dann aber in der Konzeptphase stecken. Laut IDC schaffen es 88 % aller untersuchten Proof-of-Concepts nicht in die Produktion. Das bedeutet: Von 33 gestarteten Projekten erreichen nur vier die Umsetzung.
Diese „Pilotfalle“ (Pilot Purgatory) ist in der digitalisierten Produktion kein neues Phänomen. Lokale Optimierungen – etwa in der Wartung oder Qualitätskontrolle – bringen zwar Verbesserungen in Größenordnungen von 5–10 %, aber ohne systemische Integration bleibt der Gesamterfolg aus. Die eigentliche Skalierungslücke liegt in der Organisation und Architektur begründet.
Warum der Status quo nicht reicht? Argumente für den Change
Inkrementelle Verbesserungen oder isolierte Projekte bringen nicht den gewünschten Erfolg. Industrieunternehmen stehen unter hohem Wettbewerbsdruck, kämpfen mit unsicheren Lieferketten und sinkenden Margen. Kund:innen und Regulierungsbehörden verlangen höhere Standards bei Sicherheit, Transparenz und Nachhaltigkeit.
Viele Initiativen für KI in der Industrie konzentrieren sich auf einzelne Maschinen, Linien oder Abteilungen und lassen angegliederte Prozesse außen vor. Das führt zu punktuellen Beschleunigungen, aber einem insgesamt trägen Unternehmen. Mehr Pilotprojekte bedeuten nicht mehr Fortschritt, denn nur eine systemische Integration führt zum Ziel.
Führungskräfte müssen den Change von Projektdenken zu Systemdenken vollziehen. Das bedeutet: KI sollte nicht als Zusatzmodul verstanden werden, sondern als Teil eines lebenden Steuerungssystems für das gesamte Unternehmen.
Das Industrial AI Paradoxon: Erfolgreiche Use Cases – wenig Gesamtnutzen
Selbst erfolgreiche KI-Piloten bringen häufig nur isolierte Vorteile. Daten bleiben über OT- und IT-Systeme hinweg fragmentiert – von Fertigungsanlagen über Qualitätssysteme bis zu ERP- und MES-Schichten. Predictive-Maintenance-Modelle laufen unabhängig von Qualitätsprüfungen, und Algorithmen bleiben punktuelle Lösungen. Das Problem: KI auf bestehende Einzelprozesse zu „schichten“, bringt kaum nachhaltige Wirkung
Gleichzeitig steigen die Investitionen weiter. IDC prognostiziert weltweite KI-Ausgaben von rund 632 Milliarden US-Dollar bis 2028. Gewiss: Skalierung ist unverzichtbar, doch sie muss koordiniert erfolgen, um echten Mehrwert zu schaffen.
Ohne einheitliche Datenprodukte, klar definierte Schnittstellen und domänenübergreifendes Feedback wird der Prozess lediglich komplexer, ohne eine nennenswerte Wirkung zu erzielen. Was nützt ein mit einem prädiktiven Modell optimierter Prozessor, wenn er in der Produktionsplanung nicht berücksichtig wird?
Cybernetic Thinking als Antwort: Das lernende Unternehmen
Cybernetic Thinking verspricht einen Ausweg aus der Pilotfalle. Anstatt isolierten KI-Anwendungsfällen hinterherzujagen, wird das Unternehmen selbst zu einem lernenden, adaptiven System, in dem Strategie, Betrieb und Technologie kontinuierlich aufeinander abgestimmt werden.
Wir sprechen hier vom sogenannten Cybernetic Enterprise – einem lebenden Betriebssystem für das Unternehmen, das fortlaufend analysiert, entscheidet und handelt. Gestützt auf Feedback-Loops, KI-gestützte Daten und handlungsfähige Teams entsteht eine Organisation, die sich selbst steuert und ständig verbessert.
Funktionsübergreifende Teams sind entlang domänenorientierter Value Streams organisiert. Sie tragen von Anfang bis Ende die volle Verantwortung für ihre Ergebnisse brechen Silos auf. Domänen könnten etwa Smart-Factory-Operations, Maintenance & Asset Reliability, Lieferkettenresilienz oder Kundenservice sein.
Im Mittelpunkt steht die Triade aus Organisation, Technologie und Prozess, die als ein einziges System konzipiert sein muss. Ohne diese Integration bleiben KI-Anwendungsfälle isoliert und kommen in der Skalierung nicht voran.
Zentrale Merkmale des Cybernetic Enterprise in der Industrie
Wo liegen die Grenzen des Cybernetic Enterprise?
Das Cybernetic Enterprise ist kein Allheilmittel. Seine Stärke liegt darin, Sensorik, Entscheidung und Handlung im gesamten Unternehmen zu verknüpfen und nicht darin, jede Herausforderung zu lösen. Wir möchten Ihnen daher auch ganz transparent zeigen, wo der Ansatz an seine Grenzen stößt und welche Aspekte er nicht ersetzen kann:
- Menschliches Urteilsvermögen: Strategische Abwägungen und ethische Entscheidungen bleiben in Menschenhand.
- Unvorhersehbare Ereignisse: Resilienz ermöglicht eine bessere Reaktionsfähigkeit, kann jedoch Disruptionen nicht vorhersagen.
- Datenqualität: Schlechte oder verzerrte Daten führen zu schlechten Ergebnissen, daher ist Governance unerlässlich.
- Kultur: Ohne Führung und Empowerment scheitern selbst die besten Systeme.
- Physikalische Gegebenheiten und Regulierung: Bestehende Einschränkungen in Bezug auf Produktionszyklen, Sicherheitsvorgaben und Validierungsprozesse bleiben unverhandelbar.
Cybernetic Thinking: Warum Führungskräfte jetzt handeln müssen
Punktuelle Verbesserungen und isolierte Piloten sind zu wenig. Kostendruck, Lieferkettenrisiken und regulatorische Anforderungen verlangen ganzheitliche unternehmensweite Lösungen. Das Kybernetik-Modell ist der Schlüssel zu operativer Resilienz, Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität für technische Fachkräfte und Betreiber.
Zühlke hat daher eine 90-Tage-Roadmap entwickelt, die Führungskräfte dabei unterstützt, das Kybernetik-Modell in die Praxis umzusetzen. An dieser Stelle sei auch angemerkt, dass der Prozess nicht nach 90 Tagen abgeschlossen ist. Dieser Zeitraum bildet lediglich den Einstieg in eine kontinuierliche Transformation.
90-Tage-Roadmap: Vom Pilotprojekt zur Plattform
Die Vision zu verstehen ist der erste Schritt. Entscheidend ist jedoch die Umsetzung: Aus einem isolierten Piloten muss eine skalierbare Plattform entstehen.
Die ersten 90 Tage auf dem Weg zum Cybernetic Enterprise
Diese Roadmap beschreiben wir ausführlich in unserem kommenden Whitepaper – von der Bewertung des Ist-Zustands über die Konzeption eines individuell passenden Kybernetik-Modells bis zur Umsetzung von Veränderungen in Sprints.
Darüber hinaus beschreibt das Whitepaper Rahmenbedingungen und Anwendungsbeispiele, wie sich ein solches Modell in die Praxis umsetzen lässt.
Führen Sie die Transformation über den Hype hinaus
Der Hype um KI verblasst. Wer langfristig erfolgreich sein will, braucht echte Anpassungsfähigkeit. Genau die liefert das Cybernetic Enterprise: ein Unternehmen, das kontinuierlich lernt, sich weiterentwickelt und innovativ ist.
Die Schritte der Transformation im Überblick:
- Wählen sie einen konkreten Value Stream aus, der optimiert werden soll.
- Ernennen Sie eine verantwortliche Person.
- Identifizieren Sie zentrale Prozesse und Abhängigkeiten: Was schafft wirklich Wert?
- Definieren Sie kritische Datenquellen und System-Schnittstellen.
- Legen Sie drei nicht verhandelbare KPIs als Erfolgsmaß fest.
- Integrieren Sie EU-AI-Act-Readiness in jede KI-Story.
- Etablieren Sie Feedback-Loops, um Ergebnisse und Learnings kontinuierlich zu erfassen.
- Richten Sie IT-, OT- und Business-Teams auf gemeinsame Ziele aus.
- Bauen Sie Kompetenzen für sicheren, wirksamen KI-Einsatz auf.
- Denken Sie daran: Regelmäßig überprüfen, lernen, anpassen und erneut iterieren.
Transformation ist ein anspruchsvoller Prozess, der jedoch alle Mühe lohnt. Die Zukunft gehört Unternehmen, die den Wandel als natürliche Entwicklung begreifen und schneller lernen und reagieren als die Welt sich verändert.
Woher wissen Sie, dass Sie auf dem richtigen Weg sind?
- Deployments sind kleiner und erfolgen sicherer.
- Teams diskutieren über Outcomes statt Outputs.
- Dashboards bilden Wirkung statt Aktivität ab.
- Führungskräfte steuern anhand von Live-Daten statt statischer Reports.
In der industriellen Transformation sind Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit die entscheidenden Differenzierungsmerkmale. Das Cybernetic Enterprise liefert die Architektur dafür. Die Frage ist nicht ob, sondern wie schnell Sie Ihren Feedback-Loop aufbauen.