Auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen KI-Strategie müssen Banken die sogenannte „Agentic AI“ nicht nur akzeptieren, sondern gezielt fördern. Dafür gilt es Hürden wie Legacy Systems, eine uneinheitliche Datenqualität und interne Widerstände zu überwinden – und das in einem Umfeld, das sich rasant weiterentwickelt.
Mit dem Durchbruch von ChatGPT im Jahr 2023 hat die Interaktion zwischen Mensch und KI ein neues Level erreicht und erstmals Risiken wie Prompt-Injection-Angriffe ins Blickfeld gerückt. KI ist heute allgegenwärtig, aber schwerer zu kontrollieren denn je.
Die klaffende Lücke zwischen Potenzial und tatsächlichem Fortschritt zeigt sich auch in der geringen Erfolgsquote: Laut einer aktuellen MIT-Studie verpuffen 95 % aller GenAI-Pilotprojekte ohne Mehrwert.
Doch das muss nicht so bleiben.
Unsere Erfahrung bei Zühlke zeigt: Die entscheidenden Erfolgsfaktoren haben sich durch den ChatGPT-Hype nicht verändert. In der Zusammenarbeit mit führenden Finanzinstituten haben sich vier zeitlose Prinzipien herauskristallisiert, die darüber entscheiden, wer mit KI erfolgreich skaliert und wer scheitert.
Vier zeitlose Prinzipien für erfolgreiche KI
Prinzip 1: Beim Nutzen ansetzen – nicht bei der Technik
In einer Welt, in der (fast) alles möglich ist, stellt sich nicht mehr die Frage „Was können wir entwickeln?“, sondern „Was sollten wir entwickeln?“.
Low-Code-Plattformen und generative KI haben die Schwelle für Experimente drastisch gesenkt. Neue Use Cases sind schnell gestartet, aber selten nachhaltig. Ohne strategische Einbindung verbrauchen Pilotprojekte Ressourcen, liefern aber wenig messbaren Mehrwert.
Erfolgreiche Banken geben ihren Teams klare Leitlinien: Was lohnt sich? Was nicht? Der Schlüssel liegt in einem gezielten Portfolio von Use Cases, die eng mit der Geschäftsstrategie verknüpft sind.
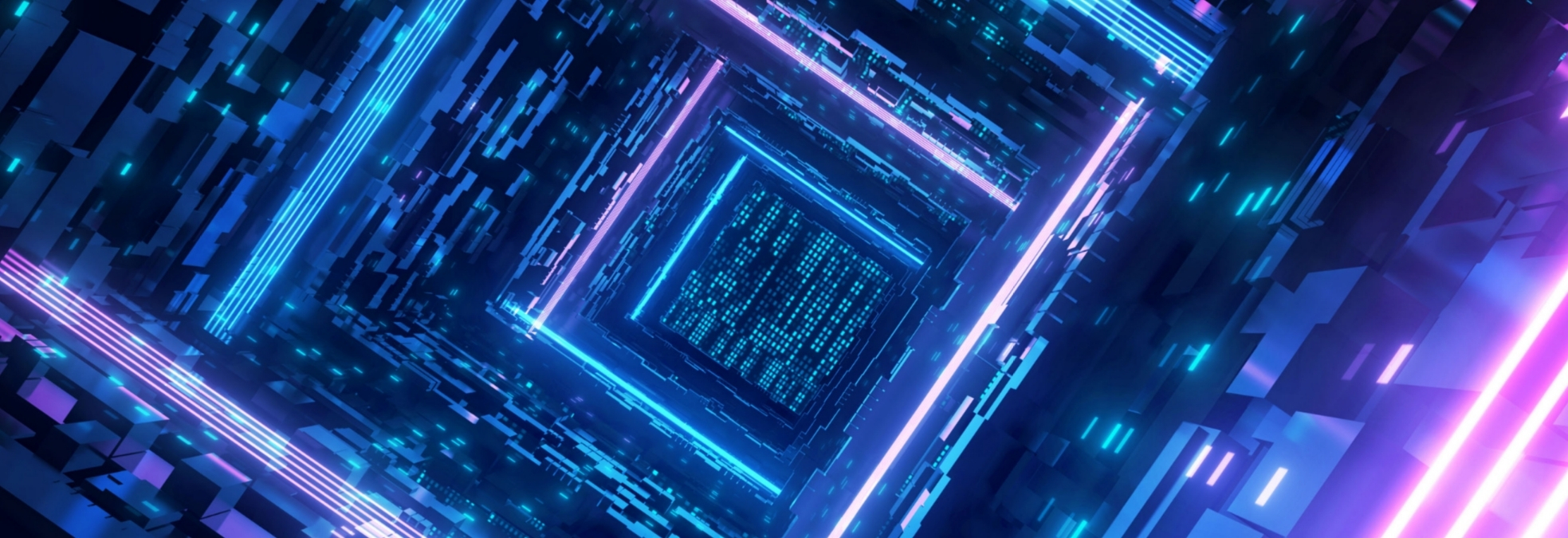
Ein Beispiel aus der Praxis: Viele Banken wollen mit RAG-basierten Chatbots (Retrieval-Augmented Generation) interne Abläufe automatisieren. In der Realität fehlt jedoch häufig der strategische Fit oder es mangelt an Budget für den tatsächlichen Rollout.
Prinzip 2: Klassische KI und Machine Learning bleiben unverzichtbar
Auch wenn GenAI viel Aufmerksamkeit bekommt – der größte messbare Mehrwert entsteht durch KI in der Finanzbranche nach wie vor durch klassisches Machine Learning. Dazu zählen Anwendungsbereiche wie Bonitätsprüfung, Betrugserkennung oder das Verhindern der Abwandungen von Kunden (sog. Churn Prevention).
GenAI ist eine spannende Weiterentwicklung, die bestehende datengetriebene Technologien ergänzt, aber nicht ersetzt.
Der entscheidende Unterschied: Klassisches ML funktioniert hervorragend mit strukturierten Daten und liefert skalierbare Entscheidungsmodelle. LLMs (Large Language Models) entfalten ihr Potenzial bei unstrukturierten Inhalten und in der Mensch-Maschine-Interaktion – etwa bei Chatbots, Wissensassistenten oder der Analyse von Dokumenten.
Die Zukunft ist ein Zusammenspiel, kein Wettbewerb: LLMs, klassische ML-Modelle und Business-Logik wirken am stärksten im Verbund.
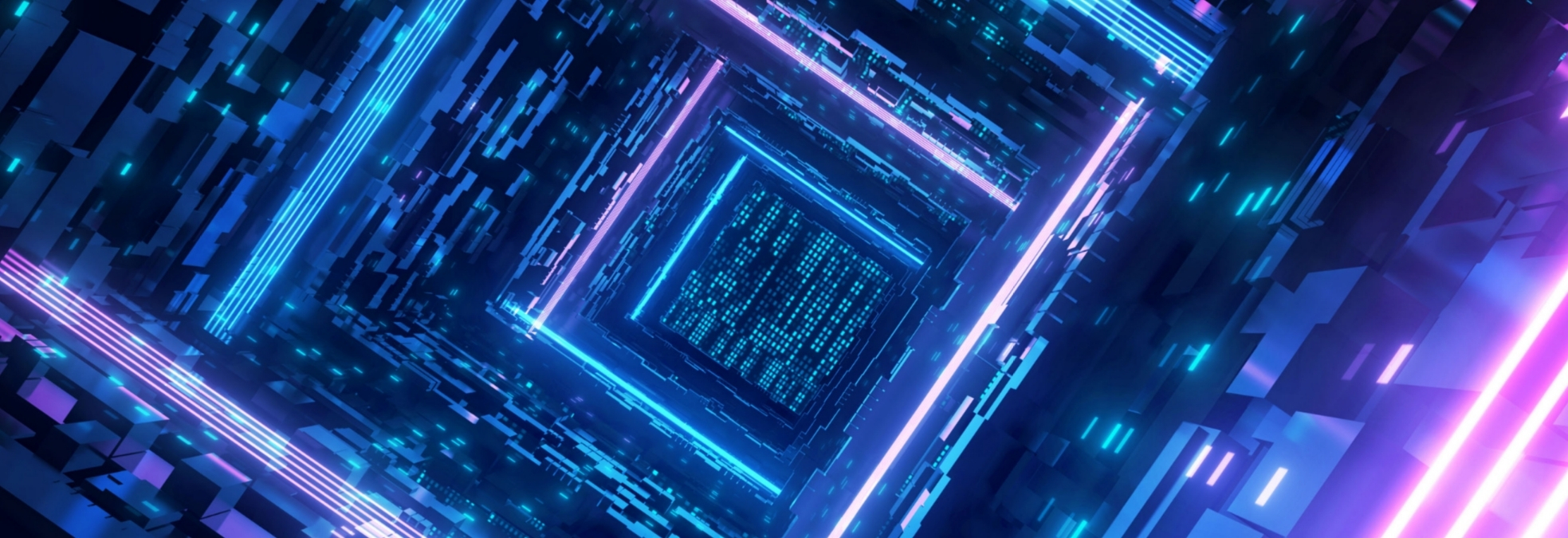
Ein Beispiel aus der Praxis: Eine globale Bank nutzt ein LLM, um Daten aus KYC-Dokumenten und CRM-Notizen zu extrahieren und zu klassifizieren. Die Ergebnisse fließen automatisiert in Compliance- und Risikomodelle ein. Das Ergebnis: höhere Genauigkeit, mehr Konsistenz und ein schnelleres Onboarding und Monitoring von Kunden.

KI
Der einfache Einstieg: ZenAI
Die erfolgreichsten Banken setzen aktuell auf KI-Anwendungen, die Mitarbeitende entlasten und die operative Effizienz steigern. Deshalb sind viele GenAI-Use-Cases für den internen Einsatz gedacht – mit den eigenen Teams als Zielgruppe. Ein sicherer, nutzerfreundlicher LLM-Chatbot für interne Zwecke ist ein idealer Einstieg in die KI-Reise. Er schafft Raum für sichere Experimente, vermittelt Nutzen im Alltag und setzt KI dort ein, wo sie sinnvoll unterstützen kann, etwa beim Beantworten von Richtlinienfragen oder beim Erstellen von Dokumenten.
Lernen Sie ZenAI kennenPrinzip 3: Der klassische Data-Science-Prozess bleibt gültig
Die Grundlagen datengetriebener Entwicklung gelten weiterhin: Noch immer sollte man eine Hypothese formulieren, anschließend Tests mit messbaren KPIs durchführen und zuletzt die Ergebnisse iterativ integrieren.
Was sich verändert hat, ist der Mensch als Einflussfaktor. Die Reaktion von Nutzer:innen beeinflusst heute das Verhalten der Modelle und das Vertrauen in sie – was die Evaluation erschwert.
Die alte Pareto-Regel gilt noch immer: Die ersten 80 % Genauigkeit sind schnell erreicht, doch für die restlichen 20 % braucht es 80 % des technischen Aufwands. Für Banken ist diese „letzte Meile“ entscheidend. Denn KI-Modelle müssen sich in regulierte Prozesse integrieren lassen, Ausnahmen abdecken und auditfähig sein.
Wichtig ist auch ein realistisches Erwartungsmanagement: Leistungsstarke KI-Lösungen sind komplex. Wer das früh klar kommuniziert, stärkt die Motivation und das Durchhaltevermögen im Team.
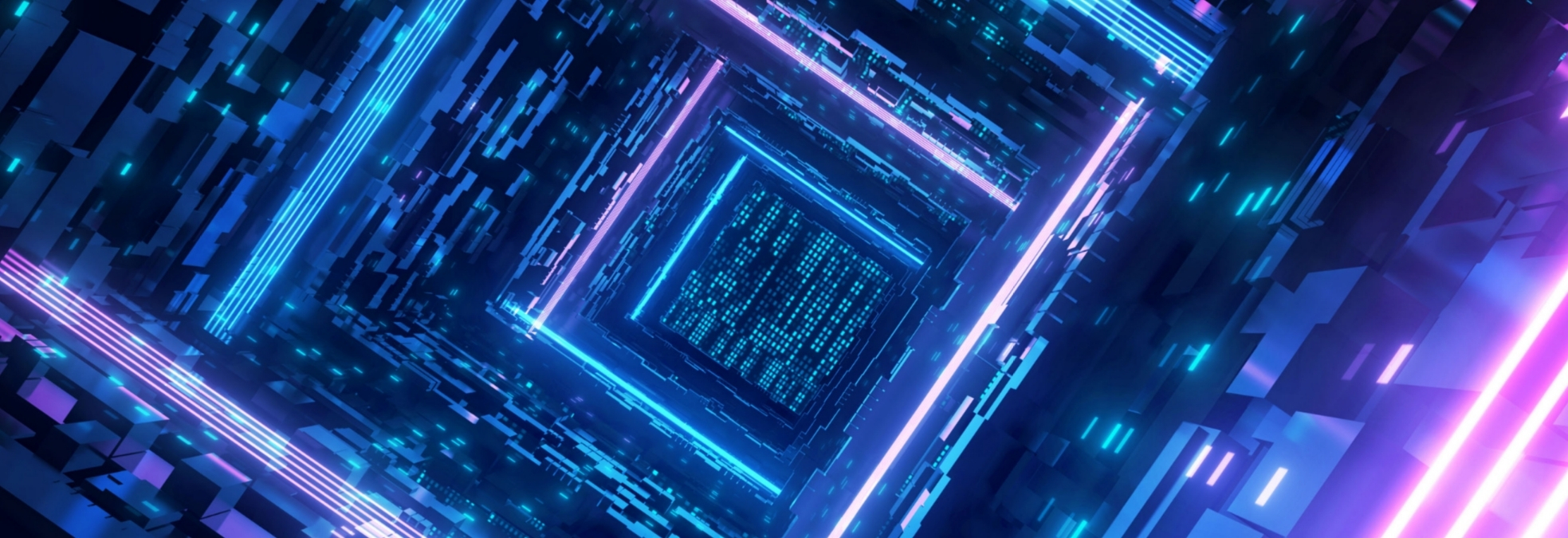
Ein Beispiel aus der Praxis: Für den Versicherer Uniqua entwickelte Zühlke einen Chatbot für Vertrieb und Operations. Fünf Monate Entwicklungszeit waren nötig, um die angestrebten 95 % Genauigkeit zu erreichen – das Level menschlicher Leistungsfähigkeit und damit Go-Live-Reife.
Prinzip 4: Ohne Basis keine Produktion
Der Hype rund um KI lenkt oft von einem ganz entscheidenden Faktor ab: organisatorische Bereitschaft.
Für Banken bedeutet das: Datenqualität sichern, Zuständigkeiten klären und Governance ernst nehmen. Denn wo niemand verantwortlich ist, hilft auch das beste Fine-Tuning nicht weiter.
Selbst bei einer stabilen Datenbasis bleibt die Integration in historisch gewachsene IT-Landschaften eine Herausforderung. Denn der Schlüssel zur erfolgreichen KI-Nutzung liegt nicht nur in der Technologie, sondern auch in einem organisatorischen Wandel.
Mit dem Aufkommen von GenAI verschärfen sich diese Herausforderungen. Die klassische KI-Governance greift nicht mehr, wenn Modelle generisch und ihre Outputs schwer vorhersagbar werden. Zudem rücken neue Datenquellen wie interne Berichte und unstrukturierte Dokumente in den Fokus. Diese sind oft unzureichend gepflegt, mehrfach vorhanden und ohne klare Zuständigkeit.
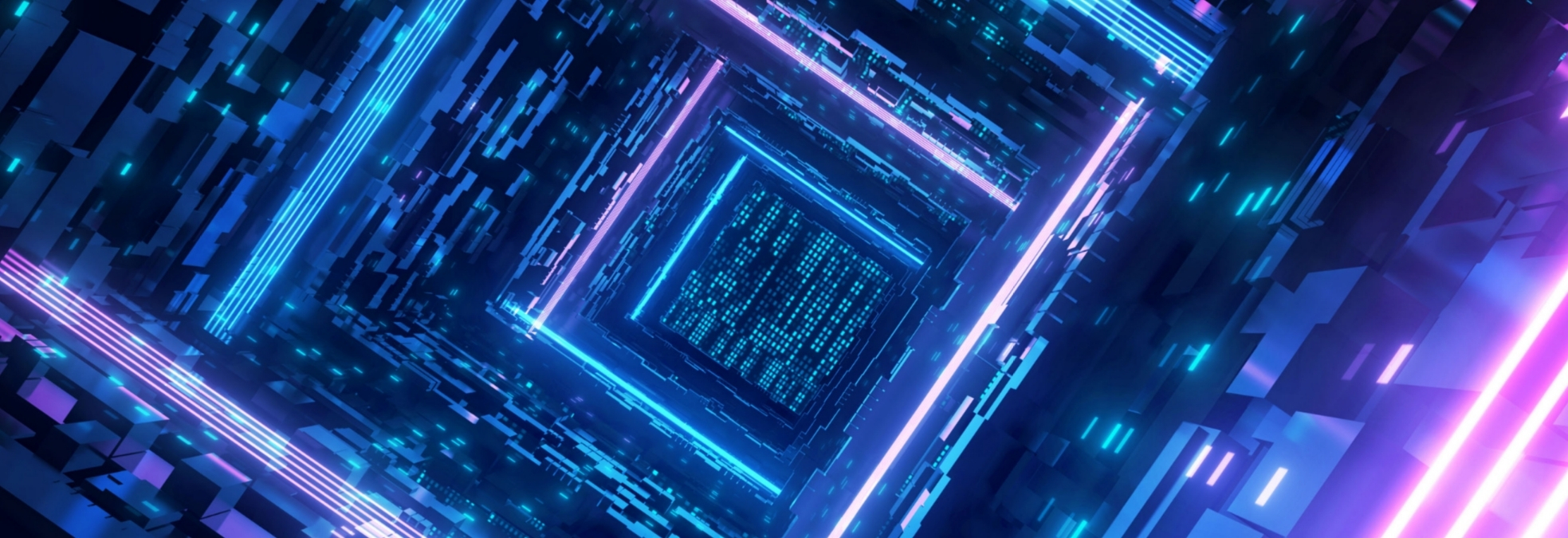
Ein Beispiel aus der Praxis: Zühlke unterstützte die BLKB dabei, den Reifegrad ihrer Datenlandschaft zu analysieren, KI-Initiativen strategisch auszurichten und datenbezogene sowie KI-Use-Cases mit dem größten Mehrwert zu identifizieren. Das Ergebnis: ein belastbares Framework, das alle Initiativen strategisch verankert und die effektive Nutzung von Daten und KI in der gesamten Organisation ermöglicht.
Jetzt handeln – mit klaren Prinzipien
Generative KI hat neue Möglichkeiten geschaffen. Aber der Schlüssel zum Erfolg bleibt derselbe: keine Technik kann Fokus, Disziplin und klare Führung ersetzen. KI hat strategische Priorität – gerade für Innovationsverantwortliche im Finanzsektor. Doch wer bewährte Prinzipien ignoriert, kommt nicht ans Ziel.
Die wichtigsten Takeaways
- Nutzen vs. Machbarkeit – Wichtig ist eine klare Priorisierung: Was lohnt sich wirklich?
- Alt und neu kombinieren – Klassisches ML und LLMs gehören zusammen.
- Realistisch bleiben – KI erfordert Geduld, Ressourcen und Präzision.
- Auf die Grundlagen achten – Datenqualität, Ownership und Governance sind Pflicht.







